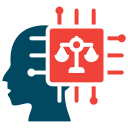This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Datenschutzbedenken in der KI-Entwicklung
Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren rasant an Bedeutung gewonnen und ist aus vielen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken. Mit dem Fortschritt wachsen jedoch auch die Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre, die durch KI-Systeme verstärkt in den Fokus rücken. Besonders der Umgang mit sensiblen Daten, die oftmals die Grundlage für KI-Anwendungen bilden, wirft komplexe Fragen auf. Diese Seite beleuchtet zentrale Datenschutzthemen, die im Zusammenhang mit KI-Entwicklung auftreten, und gibt Einblicke in die Herausforderungen, Risiken und Lösungsansätze. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die vielfältigen Aspekte des Datenschutzes im Kontext der KI zu schaffen und darüber aufzuklären, wie verantwortungsvoller Umgang mit Daten in der Praxis umgesetzt werden kann.